
Bild: Fotolia.com, kreatik
EUROPAEISCHE UNION:
Aufwind für die Kohle
Auf der politischen Tagesordnung der EU ist der Klimapakt dramatisch nach hinten gerutscht.
Kurzfristig trägt die Corona-Krise dazu bei, dass die CO2-Emissionen weltweit sinken. Nach Schätzungen der Brüsseler Denkfabrik
CEPS werden sie in der EU 2020 um 250.000 bis 450.000 Tonnen geringer ausfallen als im Vorjahr. Der Dachverband der Übertragungsnetzbetreiber
Entso-E rechnet mit einem überdurchschnittlichen Rückgang der fossilen Erzeugung, insbesondere aus Steinkohle, in der...
Möchten Sie diese und weitere Nachrichten lesen?
Testen Sie E&M powernews
kostenlos und unverbindlich
kostenlos und unverbindlich
- Zwei Wochen kostenfreier Zugang
- Zugang auf stündlich aktualisierte Nachrichten mit Prognose- und Marktdaten
- + einmal täglich E&M daily
- + zwei Ausgaben der Zeitung E&M
- ohne automatische Verlängerung
Kaufen Sie den Artikel
- erhalten Sie sofort diesen redaktionellen Beitrag für nur € 8.93
Mehr zum Thema
Haben Sie Interesse an Content oder Mehrfachzugängen für Ihr Unternehmen?
Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen zur Nutzung von E&M-Inhalten oder den verschiedenen Abonnement-Paketen haben.
Das E&M-Vertriebsteam freut sich unter Tel. 08152 / 93 11-77 oder unter
vertrieb@energie-und-management.de
über Ihre Anfrage.
© 2024 Energie & Management GmbH
Mittwoch, 08.04.2020, 10:09 Uhr
Mittwoch, 08.04.2020, 10:09 Uhr

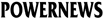

 Habeck sieht die Energiewende auf Kurs
Habeck sieht die Energiewende auf Kurs






