
Quelle: Fotolia / oqopo
POLITIK:
Bundesregierung erläutert Smart-City-Politik
Die Bundesregierung verweist auf Förderaufrufe für Kommunen und Unternehmen mit kommunaler Beteiligung.
Laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion befindet sich die Koalition noch in
Beratung darüber, wie viele Modellregionen insgesamt in die Smart-City-Förderung der Bundesregierung einbezogen werden.
Nach Angaben des Bundesbauministeriums, das die Anfrage im Namen der Bundesregierung beantwortete, werden im Rahmen des Modellvorhabens „Smarte.Land.Regionen“ seit dem 1. Januar 2021 sieben Modell-Regionen gefördert.
Es handelt sich dabei um den Landkreis Hameln-Pyrmont, den Landkreis Kusel, den Verband „Region Rhein-Neckar“, die Gemeinde Ringelai und das Ilzer Land, den Kreis Schleswig-Flensburg, die Stadt Linz und die Verbandsgemeinde Linz sowie den Landkreis Vorpommern-Greifswald. Im Jahr 2020 waren bereits der Eifelkreis Bitburg-Prüm, der Landkreis Hof, der Landkreis Mayen-Koblenz sowie der Landkreis St. Wendel in die Förderung aufgenommen worden.
Zu den zahlreichen Bewertungskriterien der Fachgutachter gehören unter anderem die Aussagekraft und Modellhaftigkeit der Smart-City-Strategie sowie die Skalierbarkeit des Ansatzes und dessen Fähigkeit zur Systemintegration und Sektorkopplung.
Um Smart Cities beziehungsweise Smart Regions zu stärken, will die Bundesregierung neben den Smart-City-Modellprojekten beispielsweise auch die Städtebauförderung und die Nationale Klimaschutz-Initiative nutzen. Dazu gehöre etwa der Förderaufruf für „Investive Kommunale Klimaschutz-Modellprojekte“. Allerdings, so räumt das Bundesbauministerium ein, liege zum aktuellen Zeitpunkt (Juni 2022) noch kein gefördertes Projekt vor, das diesem Handlungsfeld zuzuordnen sei. Der Förderaufruf, der bis Oktober 2024 gültig ist, sei im Herbst 2021 neu veröffentlicht worden. Projektskizzen könnten zweimal im Jahr eingereicht werden, heißt es aus dem Haus von Ministerin Klara Geywitz (SPD).
Die im Haushaltsentwurf 2022 veranschlagten Ausgaben von 83 Mio. Euro dienen im Wesentlichen der Ausfinanzierung der ausgewählten Modellprojekte der Jahre 2019 bis 2021. Insgesamt stünden Programm-Mittel in Höhe von rund 822 Mio. Euro zur Verfügung.
Regelmäßig zu Gast im Smart-City-Arbeitskreis von Bitkom
Ziel der Förderung sei, „die Umsetzung wegweisender investiver Modellprojekte im kommunalen Klimaschutz zu ermöglichen und durch direkte (quantifizierbare) Treibhausgasminderungen einen wesentlichen Beitrag zur schrittweisen Erreichung der Treibhausgasneutralität von Kommunen zu erreichen“, heißt es weiter. Dabei soll der Fördermitteleinsatz pro vermiedener Tonne CO2-Äquivalent auf durchschnittlich 110 Euro pro Tonne (netto) begrenzt werden. Antragsberechtigt sind laut Bauministerium Kommunen und Zusammenschlüsse von Kommunen sowie Betriebe, Unternehmen und sonstige Einrichtungen mit mindestens 25 % kommunaler Beteiligung.
Auf die Frage der CDU/CSU-Fraktion, ob die Bundesregierung auch konkrete Projekte sowie regulatorische und gesetzliche Vorhaben im Bereich Smart Home umsetzen möchte, verweisen die Beamten aus dem Bauministerium auf das Gebäudeenergiegesetz. Hier sei ein Mindeststandard der Gebäudeautomation für Wohn- und Nichtwohngebäude bereits berücksichtigt. Die Anhebung des Mindeststandards werde im Hinblick auf den Stand der Technik und einer grundsätzlichen Wirtschaftlichkeit fortlaufend geprüft. Darüber hinaus unterliegen Smart-Home-Anwendungen grundsätzlich den gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz und zum Erhalt der Funktionsfähigkeit.
Die Smart-City-Strategie der Bundesregierung ziele in erster Linie auf eine Stärkung der kommunalen Handlungsfähigkeit und die Nutzung der Digitalisierung zur Verbesserung der Lebensqualität. Entsprechend seien Vertreter aus dem Referat „Smart Cities“ des Ministeriums auch regelmäßig in einem Arbeitskreis des Digitalverbands Bitkom zu Gast und Teilnehmer der Smart Country Convention.
Nach Angaben des Bundesbauministeriums, das die Anfrage im Namen der Bundesregierung beantwortete, werden im Rahmen des Modellvorhabens „Smarte.Land.Regionen“ seit dem 1. Januar 2021 sieben Modell-Regionen gefördert.
Es handelt sich dabei um den Landkreis Hameln-Pyrmont, den Landkreis Kusel, den Verband „Region Rhein-Neckar“, die Gemeinde Ringelai und das Ilzer Land, den Kreis Schleswig-Flensburg, die Stadt Linz und die Verbandsgemeinde Linz sowie den Landkreis Vorpommern-Greifswald. Im Jahr 2020 waren bereits der Eifelkreis Bitburg-Prüm, der Landkreis Hof, der Landkreis Mayen-Koblenz sowie der Landkreis St. Wendel in die Förderung aufgenommen worden.
Zu den zahlreichen Bewertungskriterien der Fachgutachter gehören unter anderem die Aussagekraft und Modellhaftigkeit der Smart-City-Strategie sowie die Skalierbarkeit des Ansatzes und dessen Fähigkeit zur Systemintegration und Sektorkopplung.
Um Smart Cities beziehungsweise Smart Regions zu stärken, will die Bundesregierung neben den Smart-City-Modellprojekten beispielsweise auch die Städtebauförderung und die Nationale Klimaschutz-Initiative nutzen. Dazu gehöre etwa der Förderaufruf für „Investive Kommunale Klimaschutz-Modellprojekte“. Allerdings, so räumt das Bundesbauministerium ein, liege zum aktuellen Zeitpunkt (Juni 2022) noch kein gefördertes Projekt vor, das diesem Handlungsfeld zuzuordnen sei. Der Förderaufruf, der bis Oktober 2024 gültig ist, sei im Herbst 2021 neu veröffentlicht worden. Projektskizzen könnten zweimal im Jahr eingereicht werden, heißt es aus dem Haus von Ministerin Klara Geywitz (SPD).
Die im Haushaltsentwurf 2022 veranschlagten Ausgaben von 83 Mio. Euro dienen im Wesentlichen der Ausfinanzierung der ausgewählten Modellprojekte der Jahre 2019 bis 2021. Insgesamt stünden Programm-Mittel in Höhe von rund 822 Mio. Euro zur Verfügung.
Regelmäßig zu Gast im Smart-City-Arbeitskreis von Bitkom
Ziel der Förderung sei, „die Umsetzung wegweisender investiver Modellprojekte im kommunalen Klimaschutz zu ermöglichen und durch direkte (quantifizierbare) Treibhausgasminderungen einen wesentlichen Beitrag zur schrittweisen Erreichung der Treibhausgasneutralität von Kommunen zu erreichen“, heißt es weiter. Dabei soll der Fördermitteleinsatz pro vermiedener Tonne CO2-Äquivalent auf durchschnittlich 110 Euro pro Tonne (netto) begrenzt werden. Antragsberechtigt sind laut Bauministerium Kommunen und Zusammenschlüsse von Kommunen sowie Betriebe, Unternehmen und sonstige Einrichtungen mit mindestens 25 % kommunaler Beteiligung.
Auf die Frage der CDU/CSU-Fraktion, ob die Bundesregierung auch konkrete Projekte sowie regulatorische und gesetzliche Vorhaben im Bereich Smart Home umsetzen möchte, verweisen die Beamten aus dem Bauministerium auf das Gebäudeenergiegesetz. Hier sei ein Mindeststandard der Gebäudeautomation für Wohn- und Nichtwohngebäude bereits berücksichtigt. Die Anhebung des Mindeststandards werde im Hinblick auf den Stand der Technik und einer grundsätzlichen Wirtschaftlichkeit fortlaufend geprüft. Darüber hinaus unterliegen Smart-Home-Anwendungen grundsätzlich den gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz und zum Erhalt der Funktionsfähigkeit.
Die Smart-City-Strategie der Bundesregierung ziele in erster Linie auf eine Stärkung der kommunalen Handlungsfähigkeit und die Nutzung der Digitalisierung zur Verbesserung der Lebensqualität. Entsprechend seien Vertreter aus dem Referat „Smart Cities“ des Ministeriums auch regelmäßig in einem Arbeitskreis des Digitalverbands Bitkom zu Gast und Teilnehmer der Smart Country Convention.

© 2024 Energie & Management GmbH
Freitag, 24.06.2022, 16:43 Uhr
Freitag, 24.06.2022, 16:43 Uhr
Mehr zum Thema

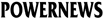
 teilen
teilen teilen
teilen teilen
teilen teilen
teilen
 Treibhausgasexperten prognostizieren zu hohe Emissionen
Treibhausgasexperten prognostizieren zu hohe Emissionen





