
Bild: Thyssenkrupp Steel Europe
WASSERSTOFF:
Wasserstoff für grünen Stahl in Duisburg
Der Essener Energieerzeuger Steag plant zusammen mit dem Stahlhersteller Thyssenkrupp den Aufbau einer Produktionsanlage für grünen Wasserstoff. Die Elektrolyseleistung beträgt 500 MW.
An einer gemeinsamen Machbarkeitsstudie arbeiten derzeit der Essener Versorger Steag, der Duisburger Stahlhersteller "thyssenkrupp Steel" und der Dortmunder Elektrolyseanbieter "thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers". Gegenstand sei der Bau eines Elektrolyseurs
am Steag-Standort in Duisburg-Walsum. Wie die drei Partner in einer gemeinsamen Mitteilung verkünden, sei außerdem die...
Möchten Sie diese und weitere Nachrichten lesen?
Testen Sie E&M powernews
kostenlos und unverbindlich
kostenlos und unverbindlich
- Zwei Wochen kostenfreier Zugang
- Zugang auf stündlich aktualisierte Nachrichten mit Prognose- und Marktdaten
- + einmal täglich E&M daily
- + zwei Ausgaben der Zeitung E&M
- ohne automatische Verlängerung
Kaufen Sie den Artikel
- erhalten Sie sofort diesen redaktionellen Beitrag für nur € 8.93
Mehr zum Thema
Haben Sie Interesse an Content oder Mehrfachzugängen für Ihr Unternehmen?
Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen zur Nutzung von E&M-Inhalten oder den verschiedenen Abonnement-Paketen haben.
Das E&M-Vertriebsteam freut sich unter Tel. 08152 / 93 11-77 oder unter
vertrieb@energie-und-management.de
über Ihre Anfrage.
© 2025 Energie & Management GmbH
Freitag, 04.12.2020, 12:44 Uhr
Freitag, 04.12.2020, 12:44 Uhr

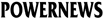

 Neue Wasserstoffachse zwischen den Niederlanden und NRW
Neue Wasserstoffachse zwischen den Niederlanden und NRW












